Der Zentralort LIMBACH hatte bereits im 14. Jahrhundert zentralörtliche Funktion. Eine Burg, deren Standort der heutige Schlossplatz gewesen ist, und die 1426 errichtete Pfarrei mit vielen Filialkirchen zeugen davon. Die öffentliche und private Infrastruktur ist sehr gut ausgebaut und kann die Grundversorgung der Gemeinde sicherstellen. Die barocke Pfarrkirche St. Valentin, deren ältesten Teile im Turm aus dem Jahr 1426 stammen, wurde 1773 in barockem Stil neu errichtet. In den Jahren 1962–1965 erfolgte abermals ein Umbau.
Ein verheerender Brand am 17. September 2003 vernichtete das Kirchenschiff und das Turmdach. Nach einem gelungenem Wiederaufbau wurde die Kirche im Jahr 2007 geweiht. Die Verbindung von alten und modernen Elementen lassen die Besichtigung der Kirche zum Erlebnis werden. Gewerbe und Handwerk sind im Zentralort gut vertreten. Die Schule am Schlossplatz wird in Kooperation mit den Gemeinden Waldbrunn und Fahrenbach als Gemeinschaftsschule geführt. Sie wird auch von Kindern der umliegenden Gemeinden sehr gerne besucht. Die Schule bietet, mitten im Grünen und in familiärer Atmosphäre, beste Bedingungen zum Lernen und ist auch für Schülerinnen und Schüler außerhalb der Gemeinden des Schulverbunds sehr beliebt. Die Wanderbahn und ein gut ausgebautes Wanderwegenetz laden zum Wandern und Fahrradfahren ein. Unvergessen bleibt ein Blick vom Hirschberg, der mit dem Hirschkopfbrunnen ein Erholungshighlight bildet. Die Limbacher Mühle hat neben Speis und Trank auch ein Gästehaus zu bieten.
Historisches: In den sog. Amorbacher Traditionsnotizen, einer Zusammenstellung verschiedener Erwerbungen durch die Benediktinerabtei Amorbach, ist der Zentralort Limbach erwähnt. Der dort genannte Abt Richard amtierte von 1011 bis 1039. In diesem Zeitraum war Limbach mit fünf weiteren Orten in den Besitz des Klosters Amorbach gekommen.
Auf ein bestimmtes Jahr lässt sich diese erste urkundliche Erwähnung des Zentralorts Limbach somit nicht festlegen. Obwohl „Limpach“ im Waldbereich des Klosters Amorbach entstanden ist, besaß es eine Burg, die wahrscheinlich zum staufischen Reichsland um Wimpfen gehörte. Ursprünglich zählte der Ort zum Herrschaftsbereich des Hochstiftes Würzburg. Anfang des 14. Jh. verkaufte der Bischof Andreas den Ort an Schenk Eberhard von Erbach, der 1318 Limbach mit der Mudauer Zent an den Mainzer Erzbischof verkaufte. Dieser gab Burg und Ortsherrschaft den Herren zu Adelsheim und ab 1488 Wilhelm Rüdt von Bödigheim zum Lehen. Die Burg wurde 1525 durch Bauern zerstört und im Jahre 1780 wegen Baufälligkeit abgebrochen. Während der Zeit der kurmainzischen Herrschaft (1318- 1803) diente das „Schloss“ den Oberschultheißen von Kurmainz als Amtssitz.
1803 kam Limbach durch den Reichsdeputationshauptschluss an den Fürsten zu Leiningen. 1806 erhielt Baden die Souveränität. Zuständiges Amt war in der Mainzer Zeit die Kellerei Mudau im Oberamt Amorbach. Mit dem Übergang an Baden wurde ab 1813 Buchen zuständig und ab 1921 Mosbach.
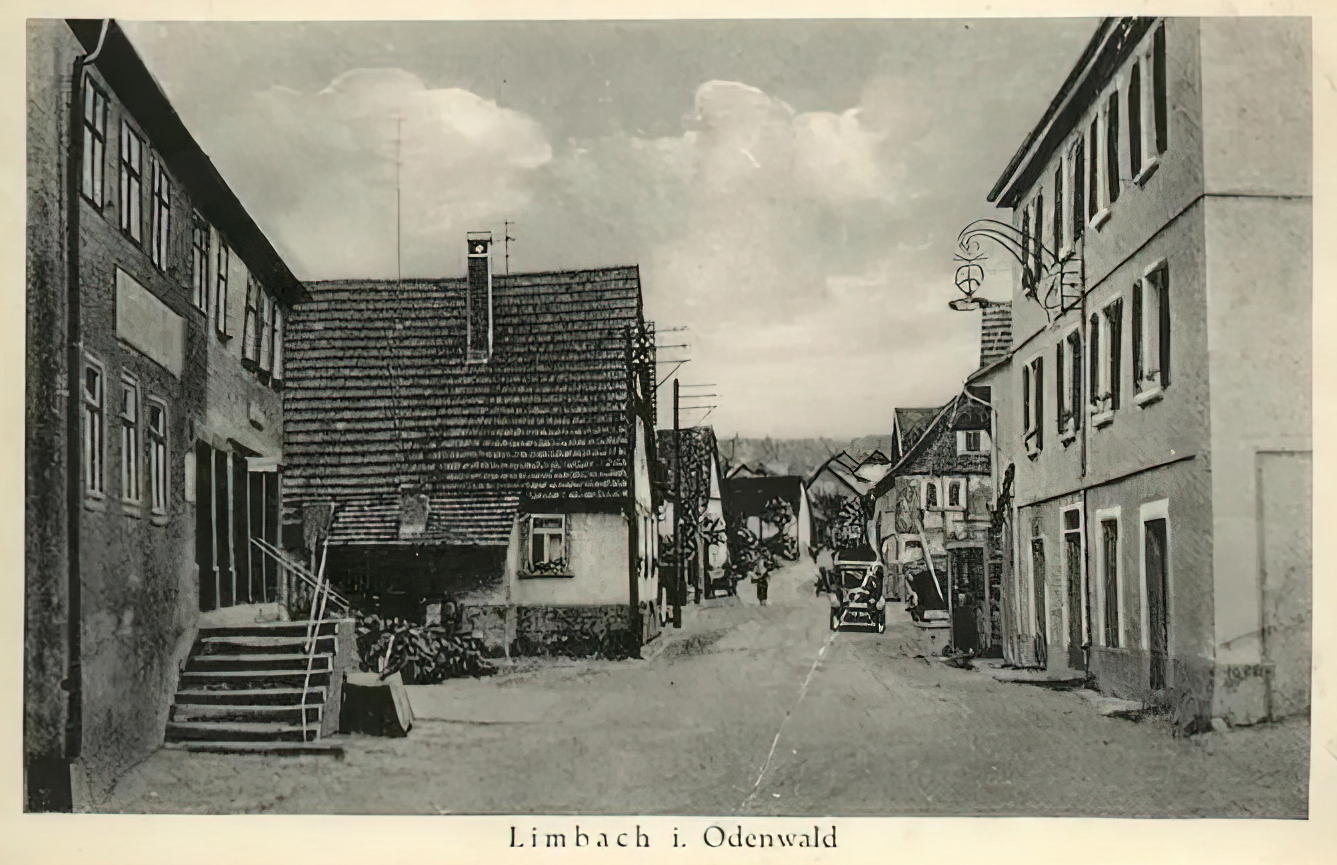
In der Hauptsache steht Limbachs erwachsene Bevölkerung in harter Berufsarbeit und ist menschlich etwas schwer zugänglich; aber in ihrem Herzen seelengut und nicht ohne Humor, besonders wenn sie einmal in „Schwung“ gekommen ist. Die Limbacher sind keine dörfliche, scheue Einsiedler, sondern sie lieben außerhalb ihres Berufs die Gemeinschaft und Geselligkeit, die sich im Zusammenfinden in Vereinen widerspiegelt.“
Julius Gor, „Limbach im Neckar Odenwald Kreis.
10 Jahre Gemeindepolitik seit der Reform“
Aus dem Netz gefischt. Limbach auf youtube.
Förster Wolfgang Kunzmann setzt in seinem Revier rund um Limbach im Odenwald auf eine naturnahe Bewirtschaftung. Dabei bekommt er ungewöhnliche Hilfe: von Dietmar Gieser und seinem Rückepferd Mira. Über eine alte Tradition, die wieder in die Wälder zurückkehrt. Wir haben das Team im Wald begleitet: https://wosonst.eu/aufs-pferd-gekommen/
Sommer 2023, aus einem Livestream des Museums Wagenschwend. Welche Visionen hat ein Bürgermeister einer Gemeinde tief im Odenwald? Hat er überhaupt Zeit, Visionen zu entwickeln? Und wie hält man die Gemeinde im vermeintlichen Hinterland lebens- und liebenswert? Fragen über Fragen, und ein interessantes Interview mit Bürgermeister Torsten Weber aus Limbach.
Sechs Gastwirtschaften und dicke Bündel von Klagen
Er muss es wissen: Pfarrer Valentin Throm/Limbach berichtet.
„Der Drang nach Geselligkeit hat sich früher meist in Sippen- und Nachbarschaftsgemeinschaften geäußert. Verwandtschaftsbesuche in der engeren und weiteren Heimat, besonders zur Winterszeit, aber auch anläßlich von Orts- oder Familienfesten und Feierabendbänke vor den Häusern, wo sich die Nachbarn zusammenfanden, gehören noch zu den Erfahrungen meiner Jugendzeit. Und auch die sogenannten „Vorsätzabende“ von denen Eltern und Großeltern zu erzählen wußten, sind Beispiele dafür.
Es sei nicht verschwiegen, daß dieser Zug zur Geselligkeit auch Gefahren in sich birgt. Gastwirtschaften, die der Geselligkeit dienen sollten, gab es immer. Für Limbach ist, bei nur ca. 15 Familien nach dem Dreißigjährigen Krieg, auch eine Gastwirtschaft bezeugt und im 19. Jahrhundert waren es sogar sechs Gastwirtschaften (Zum Roß; Zur Krone; Zum Adler; Zum Löwen; Zum Ochsen; Zum Hirsch).
In den Pfarrakten finden sich dicke Bündel von Klagen über Alkoholismus einzelner, der sich aber in Zeiten der Arbeitslosigkeit auch zur Seuche auswuchs. Viele Klagen finden sich über unbefugte Teilnahme Jugendlicher an öffentlichen Tanzveranstaltungen. Im positiven Sinn hat sich der Geselligkeitstrieb stets, wie auch heute noch, in Zusammenschlüssen zu Vereinen ausgewirkt.
Vereinszusammenschlüsse dienen freilich nicht nur der Geselligkeit; darin äußert sich auch das Pflichtbewußtsein zur Gemeinnützigkeit (Feuerwehr, Pflege von Gesang und Musik. Ausgestaltung des Gottesdienstes, Pflege des Sports, Betreuung der heimatlichen Landschaft u.a.m.).
Mit solch geprägten Menschen müßte, zusammen mit den großartigen Errungenschaften der modernen Zeit, eine hoffnungsfrohe Zukunft zu gestalten sein. Freilich werden sich die Bürger der Odenwaldgemeinden auch immer wieder auf die guten Seiten …“
Weide und Übertriebsrechte
Aus der Ortschronik von Laudenberg, Bernd Fischer:
„Alle benachbarten Gemeinden, Limbach, Krumbach, Balsbach, Unterscheidental, Langenelz, Einbach und Scheringen, haben von alters her das Recht die Laudenberger Gemarkung unbegrenzt mit ihrem Rindvieh und mit den Schweinen zu beweiden.
So wie die Laudenberger berechtigt sind alle benachbarten Gemarkungen mit diesem Getier zu übertreiben. Weil es aber wegen der Übertriebsrechte immer wieder zu Reibereien und Unmuß gekommen ist, hat man versucht, zwischen einzelnen Gemeinden Regelungen zu treffen, durch die das generelle Weiderecht auf bestimmte Gemarkungsteile und auf bestimmte Zeiten beschränkt würde. Es sieht so aus, als ob bisher nur mit der Gemeinde Limbach eine Einigung erreicht werden konnte.
So war den Limbachern nur gestattet, wenn es Bucheckern (Bücheln) gab, zwischen dem St. Burkartstag und dem St. Georgentag ihre Schweine über die Brunnenwiesen zwischen Feld und Wiesental herein in den Buchenwald auf den sog. Pfälzischen Wüsten Gütern zu treiben,
also in die heutigen Walddistrikte Hainberg und Bergwald sowie in den Mühlwald an der Elz.
Über die Brunnenwiesen führt ein abgesteinter Trieb, für den die Limbacher den dortigen Güterbesitzern Zins zu zahlen hatten. Der Ertrag der Schweinemast muß aber für die Limbacher nicht interessant genug gewesen sein.
Deshalb verzichteten die Limbacher allzugerne auf ihr Übertriebsrecht, wenn dafür der Zins entfiele. Auch für ihr Vieh haben die Limbacher nur in dem selben Distrikt das Weiderecht.
Für alle Weideberechtigten gilt das Gebot, sich bei der Ausübung ihrer Rechte auf fremder Gemarkung rücksichtsvoll (zimblich) zu verhalten. Dies ist so zwischen den allermeisten Nachbargemeinden. Nur mit den Balsbachern gibt es immer wieder Streit. Sie treiben mit ihren Schweinen und mit den Schafen sehr rücksichtslos (unnachtparlich), auch mit ihrem Rindvieh, mit dem sie nur im Wald der Junker bleiben sollten.„
